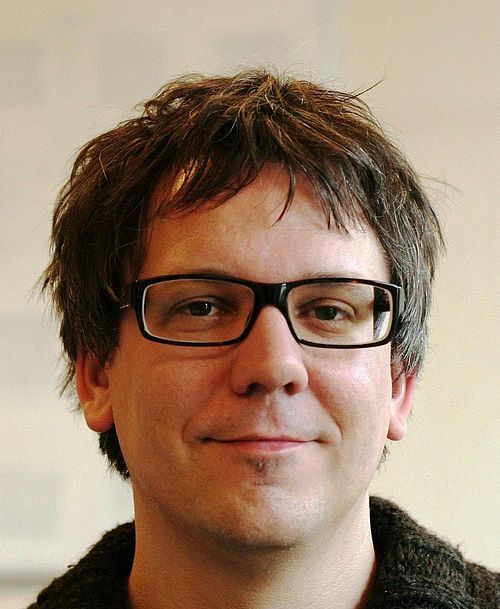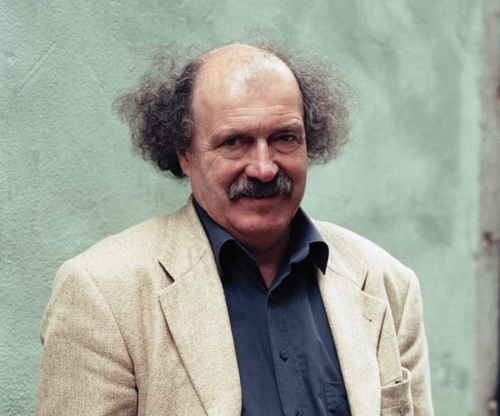Arbeitsfelder und Berufsperspektiven
Im Umgang mit Sprache und reflektierter Sprachbetrachtung, in der Erfassung von Texten und literarischen Gattungen stellen sich durch stete Übung zunehmende Gewandtheit und eigene Ausdrucks- und Stilsicherheit ein. Das Studium der Germanistik führt nicht nur zu einem intensiven Kennenlernen der Eigenheiten der deutschen Sprache und der Geschichte der deutschsprachigen Literaturen, es führt auch zu Erfahrungen der sprachlichen und kulturellen Differenz und stellt Möglichkeiten bereit, solche Differenzen zu beobachten, zu benennen und zu verarbeiten.
«Soft Skills»
Lesen, Schreiben, Sprechen. Wer Germanistik studiert, erprobt und trainiert seine analytischen und kreativen Fertigkeiten im Umgang mit Sprache und Literatur. Dazu gehören Techniken des analytischen Lesens, des Gliederns und Darstellens, der Themenfindung und Disposition, der rhetorischen Gestaltung und der mündlichen Präsentation.
Suchen und Finden. Auch Germanistinnen und Germanisten suchen dort, wo andere dies tun: in Nachschlagewerken, Lexika, Bibliographien und im Internet. Oft kommt es aber gerade darauf an, Orte aufzustöbern, wo bisher noch niemand gesucht hat und wo deshalb noch einiges zu holen ist. Aber wie erkenne ich im Dickicht des schon Bekannten und Beschriebenen das noch Unerforschte? Manchmal hilft eine ästhetische Lösung, eine bestimmte Begriffsprägung etwa oder eine ungewöhnliche Fragestellung, um dem scheinbar Längstvertrauten das Neue und Unerhörte zu entlocken.
Erklären als Übersetzen. Jemandem etwas erklären, sei es ein technisches Produkt oder einen geschichtlichen Sachverhalt, ein fremdes Wort oder einen unklaren Begriff, eine wissenschaftliche Theorie oder ein geheimnisvoll wirkendes Kunstwerk – das bedeutet, dieses jeweils unklare Phänomen in Worte zu fassen, es in eine zeitgemässe, allgemeinverständliche Sprache zu bringen. Germanistinnen und Germanisten sind selbst auch nur in den wenigsten Wissensgebieten Experten aus eigenem Fachwissen; sehr wohl aber verfügen sie über Vermittlungs- und Erklärungskompetenz, weil sie gelernt haben, die oft genuin sprachlich bedingten Hürden und Verständnisschwierigkeiten zu erkennen und zu überwinden. Sie können Vorschläge zur Begriffsbestimmung machen, anschauliche Vergleiche entwickeln, die Herkunft und Gebrauchsweise von Redewendungen, Theoriemodellen und Denkmustern ausleuchten – das ist ein erster Schritt, diese ‹von innen her› zu verstehen und zugleich ‹nach aussen› zu vermitteln bzw. zu übersetzen.
«Hard Facts»
Die fünf grossen Tätigkeitsfelder für GermanistInnen umfassen Medien, Public Relations, Bildung, Forschung und Lehre sowie Kunst und Kultur.
1. Medien
- Eigene journalistische Arbeit in Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet: Recherche und Aufbereitung von Themen, Darstellung von Sachverhalten, Formulierung von Zusammenhängen und Adressierung eines Publikums
- Fachbuch- und Literatur-Kritik
- Redaktionelle Bearbeitung von Texten und Betreuung von Publikationen in Medien und Verlagswesen
2. Public Relations & Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit für gesellschaftliche Einrichtungen oder private Unternehmen
- Soziale Kommunikation: Vermittlung und Zusammenführung von komplexen Arbeitsabläufen oder Sachverhalten
- Werbung und Informations-Gestaltung für Produkte, Ereignisse, Firmen oder Institutionen
3. Bildung
- Lehrtätigkeit im Schulfach Deutsch, im allgemeinen Sprach- und Literaturunterricht sowie in der Fachdidaktik
- Erwachsenenbildung: Rhetorik-Kurse, Schreib-Seminare, Anleitung von Lektüregruppen etc.
4. Forschung & Lehre
- Tätigkeit in wissenschaftlichen, geschichtlichen, literarischen Archiven
- Wissenschaftliche Recherche zu sprach- und literaturwissenschaftlichen Themen (freie Forschung, Auftrags- und Projektforschung)
- Publizistische Dienstleistungen: Erstellen von Wörterbüchern, Lexika, Lehrbüchern; Verfassen von Studien und Fachbüchern
- Wissenschaftsmanagement: Arbeit als FachreferentIn an Fördereinrichtungen (für den Schweizerischen Nationalfonds und andere Stiftungen); Organisieren von Tagungen, Projekten, Nachwuchsforschung
- Akademische Lehre: Ausbildung von Studierenden und wissenschaftlichem Nachwuchs in Germanistik, Sprach- und Literaturwissenschaft an in- und ausländischen Universitäten und Fachhochschulen
5. Kunst und Kultur
- Planung & Gestaltung von literarischen Buch-, Veranstaltungs- oder sonstigen Programmen
- Theater: Regie und Dramaturgie
- Verfassen von Programmen und Booklets zu Ausstellungen und Konzerten
- Eigenes Schreiben künstlerischer Texte
Quick Links